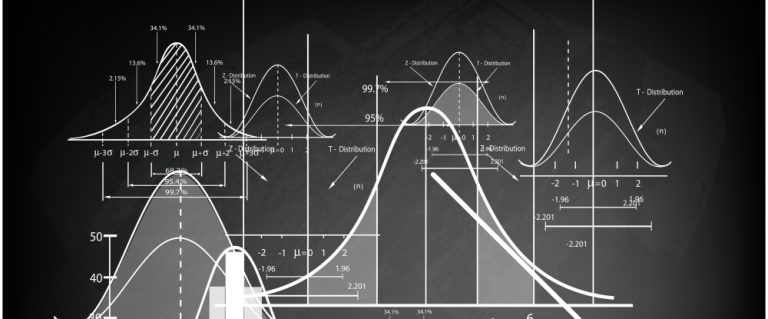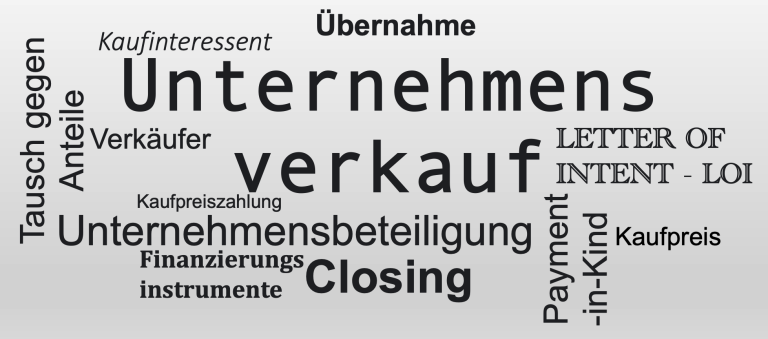M&A ist eines der wichtigsten Werkzeuge, welches Unternehmen dazu dient, auf veränderte Umweltbedingungen zu reagieren. Im selben Umfang, wie sich verschiedene Organisationen voneinander unterscheiden, erfordern sie eine unterschiedliche Herangehensweise im Transaktionsprozess. Wie aber unterscheidet sich der Transaktionsprozess im Hinblick auf die Unternehmensgröße?
Marktwirtschaftlicher Wettbewerb kann so einfach sein: Unternehmensgröße verschafft Wettbewerbsvorteile (Skalenerträge – Size Matters). Der Bau einer modernen Halbleiter-Chipfabrik kostet heute etwa USD 20 Mrd., die Entwicklungskosten für ein Flugzeug wie dem Dreamliner (Boing 787) betrugen laut Seattle Times über USD 32 Mrd.
Bei diesen Summen wird sofort deutlich, dass in den jeweiligen Industrien (abgesehen von Nischen) Oligopole vorherrschen. Für intensiven Wettbewerb ist kein Platz.
Politik und kognitive Dissonanzen
Die Intuition ist klar: kleinere Organisationen und Unternehmen haben kürzere Entscheidungswege. Politik und unternehmensinterne Bürokratie, die Prozesse verlangsamen können, spielen eine untergeordnete Rolle. Nichtsdestotrotz spielt der Faktor Mensch auch in KMUs eine Rolle.
Der Gleichklang von Handlung und Haftung (Eigentum und Kontrolle) führt nur dann zu weniger politischen, sondern marktnäheren Entscheidungen, wenn persönliche Beziehungen, Stolz und Eitelkeit erfolgreich ausgeblendet werden.
Gerade die persönliche Ebene kann zu einem willkürlichen Abbruch der Verhandlungen führen, auch wenn die Zahlungsbereitschaft an sich vorhanden ist bzw. ein gutes Angebot vorliegt und der Abschluss des Kaufvertrages, von außen betrachtet, eigentlich reine Formsache sein sollte.
Hinzu kommt: Psychologische Fallen im Entscheidungsprozess sind unabhängig von der Unternehmensgröße. Unternehmer sind zu Recht stolz auf das Unternehmen und seine Kultur, die sie über Jahre entscheidend geprägt haben.
Wenn ein Kaufinteressent bei der Prüfung des Unternehmens bestimmte Dinge feststellt, die sich mit den Gefühlen und der Wahrnehmung des Unternehmers nicht decken, führt das zu kognitiven Dissonanzen, die in seltenen Fällen dadurch aufgelöst werden, dass dem Interessenten bescheinigt wird, er sei ohnehin ungeeignet für die Übernahme des Unternehmens. Die Verkaufsverhandlung kann im schlimmsten Fall einseitig abgebrochen werden.
Diese Konstellation tritt bei größeren Transaktionen kaum auf, da der gesamte Transaktionsprozess, insbesondere aber auch die Schnittstellen zwischen Investoren und Verkäufern stärker formalisiert sind. Dazu kommt: in der Regel ist der Preis das Hauptentscheidungskriterium, weil das Management im Zuge der Anteilsübernahme nicht ausgetauscht wird.
Hierarchie und Entscheidungsfindung
Ohne Frage sind große Firmen hierarchischer und arbeitsteiliger organisiert. Wenn die Fachabteilung aufgrund der bestehenden Komplexität des Unternehmens von einem weiteren Zukauf in einer bestimmten Sparte abrät, dann wird der mögliche Transaktionsprozess von der unternehmensinternen M&A Abteilung erst gar nicht geprüft, und zwar unabhängig von der Attraktivität des Verkaufspreises.
Die Abwesenheit solcher Silo-Entscheidungsfindung ist der große Vorteil kleiner, schlagkräftiger Organisationen. Richtlinien und Komitees, die im Zusammenspiel gute Entscheidungen hervorbringen sollen, dies tatsächlich aber nicht immer tun, spielen hier keine Rolle.
Stattdessen gibt es eine flexiblere, im positiven Sinne opportunistischere Herangehensweise. Persönliche Hinderungsgründe und ein beschränktes Zeitbudget der Entscheidungsträger sind dagegen die Haupttreiber für Verzögerungen im Transaktionsprozess. Große firmeninterne M&A Teams, die über großzügige zeitliche, technische und fachliche Ressourcen verfügen, um ein Zielunternehmen zu prüfen, fehlen in aller Regel. Das wiederum bedeutet, dass die Prüfung des Unternehmenszukaufs parallel zum Tagesgeschäft erfolgen muss.
Risiko und Unternehmenskultur
Großunternehmen bieten feste Strukturen und hohe Arbeitsplatzsicherheit. Das führt nicht selten zu einer defensiveren Risikokultur. In großen Vermögensverwaltungen muss die Wertentwicklung der Anlagen beispielsweise nicht spektakulär sein, damit das Management solide verdient.
Zukäufe werden unter diesen Rahmenbedingungen anders gehandhabt als bei von Eigentümern geprägten Unternehmen, wo der Ehrgeiz und die Vision des Inhabers die Strategie wesentlich beeinflussen. Das gilt ebenso für den Transaktionsprozess.
Das Phänomen Gruppendenken, das abweichende Ansichten nicht honoriert, kann zwar grundsätzlich in jeder Organisationsform auftauchen. Die Risikobereitschaft der Entscheidungsbeteiligten unterscheidet sich aber grundlegend.
In großen Organisationen müssen interne Verrechnungspreise und Arbeitsleistungen zwischen Abteilungen zwangsläufig willkürlich festgesetzt oder notdürftig geschätzt werden. In diesem Kontext wiegt ein gescheiterter Unternehmenszukauf im persönlichen Kalkül der Verantwortungsträger oftmals schwerer als ein geglückter. Die vergütungsmäßige Anreiz- und Chancenstruktur ist nicht symmetrisch, d.h. sie bildet nicht die unternehmerischen Chancen und Risiken 1:1 ab.
In einer experimentellen Befragung von 1.500 Managern wurde die extreme Verlustaversion greifbar gemacht. Im hypothetischen Fall stand eine Gewinnchance von USD 100 auf USD 400 im Raum. Statt die risikoneutrale, (erwartungswert-)optimierende Strategie zu wählen, die den Geschäftswertbeitrag maximiert und eine Verlustchance von 75 % in Kauf nimmt, waren die Befragten nur bereit, die vorgegebene Investitionschance zu ergreifen, wenn die Verlustmöglichkeit unter 19 % lag. (siehe Lovallo et al. (2020). Your company is too risk-averse: Here’s why and what to do about it. Harvard business review : HBR, 98(2)).
Die Autoren kommen daher zu dem Schluss, dass Manager in hierarchischen Organisationen risikoscheu werden, weil die Anreize und Kontrollprozesse der Unternehmen aktiv dazu beitragen, dass auch lohnenswerte Risiken nicht eingegangen werden. Gefahrenabwehr und das Wert legen auf Sicherheit werden großgeschrieben. Ein Beispiel aus der Praxis: ein großer deutscher Stromnetzbetreiber hat sich seine Safety Culture (inkl. Roadmap) zertifizieren lassen, wobei die Tatsache, dass sich Risiken nicht ganz vermeiden lassen, immerhin in der Formel „So niedrig wie angemessen möglich“ zum Ausdruck gebracht wird.
Umgekehrt kann aber auch der Prestige-Gewinn durch Unternehmenszukäufe und die damit einhergehende Unternehmensgröße als Argument in Gehaltsverhandlungen dienen, sodass auch wertvernichtende, überteuerte Zukäufe auf der persönlichen Ebene gewinnbringend sein können (Beispiel: die Daimler Übernahme von Chrysler). Unangemessene Risikoaversion und überteuerte Zukäufe schließen sich also nicht grundsätzlich aus und können in ein und demselben Unternehmen auftreten.
Welche Bedingungen begünstigen den Akquisitionserfolg?
Empirisch lassen sich Charakteristika herausfiltern, die tendenziell dazu führen, dass auch große Zukäufe zum Erfolg führen. Organisationen, die außerhalb ihrer Kernkompetenzen Zukäufe tätigen, scheitern häufiger. Prof. Robert Bruner (University of Virginia) nennt diese Zutaten zu einem erfolgreichen Zusammenschluss „Domain Knowledge“ (Deals from Hell: M&A Lessons that Rise Above the Ashes). Daimler-Benz als integrierter Technologiekonzern Anfang der 90er Jahre mit der Deutschen Aerospace und AEG war ein verfehltes Experiment dieser Kategorie. Zukäufe wurden außerhalb des Fachwissens und der Kern-Unternehmensexpertise durchgeführt.
Selbst der damalige Daimler-Chef Edzard Reuter bekannte 20 Jahre später freimütig: „Am Ende unserer Idee … stand ein Scheitern.“ Die Elektrokomponenten von AEG, die damals bereits für E-Motoren genutzt wurden, wurden in den Folgejahren nicht weiterentwickelt, was wiederum zeigt, dass das „Wie“, d.h. die Umsetzung der Post-Merger Integration und die Strategie ebenso entscheidend ist wie die Frage: sollte die Transaktion unter den gegebenen Bedingungen überhaupt stattfinden?
Ein zweiter wichtiger Faktor ist die Ähnlichkeit der Firmenkultur und des Management Stils. Auch hier muss man nicht lange suchen, um auf Daimler und den Zusammenschluss mit Chrysler als mahnendes Beispiel zu stoßen. Aus anfänglichem Spott in der Berichterstattung bezüglich der Gehaltsunterschiede zwischen deutschem und amerikanischen Unternehmensteil wurde ziemlich schnell Ernst: 17 Monate nach Abschluss der Fusion trennte sich das Unternehmen vom höher bezahlten US-Vorstand – formal der Nummer zwei im Unternehmen.
Das Misstrauen und die unterschiedliche Arbeitsweise waren aber nicht auf die Chefetage beschränkt. Chrysler als vertriebsgesteuerte Organisation und Daimler als hierarchisches Unternehmen mit Fokus auf automobile Ingenieurskunst passten nicht zusammen.
Im Gegensatz zur Sprinkleranlage im Büro in Detroit, die sich abstellen ließ, um den deutschen Vorständen das Rauchen im Büro zu ermöglichen, ließen sich andere Gewohnheiten und Werte nicht so einfach nach Übersee exportieren und so stieg an dem Tag, an dem der Vater der Fusion sein Amt bei Daimler niederlegen musste, der Unternehmenswert um 10 %. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich etwa 35 Mrd. EUR bereits in Luft aufgelöst, weitere 5 Mrd. EUR sollten im Laufe der Trennung folgen.